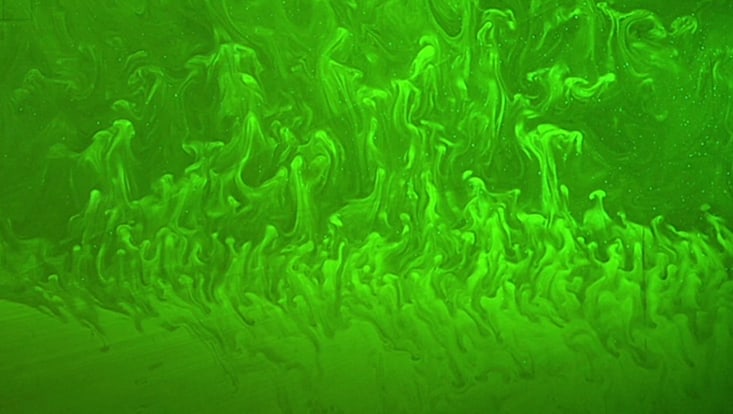für Meereskunde
Gespräch mit Jürgen Sündermann
14. Mai 2024, von Kaja Scheliga

Foto: Jürgen Sündermann
Jürgen Sündermann war von 1989 bis 2002 Direktor des Zentrums für Meeres- und Klimaforschung (ZMK), dem das Institut für Meereskunde (IfM) angehörte. In diesem Interview erzählt er unter anderem von seiner Zeit am Institut.
Wie fühlt es sich an, wieder in Hamburg zu sein, insbesondere am IfM?
Ja, das ist meine wissenschaftliche und meine arbeitsmäßige Heimat. 1962 habe ich hier angefangen am Institut für Meereskunde, das ist ziemlich lange her. Hamburg hatte gerade eine verheerende Sturmflut erlebt, und wir haben die ersten Rechnungen durchgeführt, um eine künftig sichere Deichhöhe zu ermitteln.

Jürgen Sündermann
Ich habe zwar, wie das ja vernünftig ist in der akademischen Karriere, nicht immer hier im Institut gearbeitet. Nach der Promotion und Habilitation habe ich sieben Jahre im Wasserbau an der Universität Hannover gewirkt. Ich bin auch viel im Ausland gewesen. Früher gab es die Einrichtung des Forschungsfreisemesters, da konnte man ein halbes Jahr woanders hingehen. Da bin ich in Hawaii, auch in der Sowjet Union und Italien gewesen und habe dort gearbeitet, aber die Heimat ist schon das Institut für Meereskunde gewesen.
Das Institut war ja ziemlich klein, als ich damals anfing. Das Hauptgewicht lag auf der theoretischen Ozeanographie, also zum Beispiel die Modellierung der ozeanischen Strömungen. Eine experimentelle Ozeanographie gab es praktisch nicht.
Das haben wir dann alles entwickelt – bis zum eigenen Forschungsschiff und schließlich der Fernkundung des Meeres. Diese Zeit, in der die Geowissenschaften zusammengewachsen sind in Hamburg und einen neuen Stil der Zusammenarbeit eingeführt haben, indem wir die verschiedenen Disziplinen und Arbeitsgruppen (die Techniker, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Professoren) zusammengeführt haben und interdisziplinäre Projekte, meist bezahlt aus Drittmitteln, durchgeführt haben – die war einfach toll.
Was sind die Momente, die Ihnen am meisten in Erinnerung sind?
Zunächst natürlich, nach dem Studium, die Anwendung der Physik und Mathematik auf die Dynamik des Ozeans und die Einbeziehung weiterer Geowissenschaften wie Meteorologie und Geophysik. Dann die Struktur der universitären Forschung und Lehre. Es war ja die Achtundsechziger Zeit. Als die Universität sich neugestaltet hat, und das ist in Hamburg besonders intensiv gewesen. Ich habe den legendären Auftritt von Rudi Dutschke zum Beispiel miterlebt und ich bin auch einer der ersten gewesen, der als Assistentenvertreter in der Fakultät auftrat. Die Reformen sind an dieser Universität sehr positiv verlaufen, indem wir einen Gemeinschaftsgeist entwickelt haben.
Zum Beispiel im Sonderforschungsbereich 94 – dem größten, den die DFG je finanziert hat – der hatte in dieser Gestalt schon demokratische Züge. Und der hat auch verlangt, dass die verschiedenen Wissenschaftsgebiete zusammenarbeiten. Es konnte einem nicht egal sein, was die anderen machen und man wurde dafür gewissermaßen auch herangezogen, wenn etwas dort nicht gut war.
Das hat mich in der Folgezeit sehr geprägt. Ebenso die Zusammenarbeit mit den benachbarten Fächern, mit den verschiedenen meereskundlichen Einrichtungen in Hamburg.
Es ist eine große Gemeinschaft von marinorientierten klimarelevanten Disziplinen gewachsen, die auch dazu geführt hat, dass das Max-Planck-Institut für Meteorologie gegründet wurde.
Sie haben in unserem Vorabgespräch auch schon erwähnt, dass sie während Ihrer Zeit am IfM — und nicht nur am IfM — Frauen gefördert haben und darauf geachtet haben, Frauen für Führungsrollen zu berücksichtigen, zum Beispiel für die Leitung einer Arbeitsgruppe oder auch einer Expedition. Wie sah das aus?
Als ich hierhergekommen bin, 1962, da waren im Institut für Meereskunde viele Frauen, aber die waren vorwiegend damit beschäftigt die numerischen Ergebnisse graphisch zu gestalten. Es gab ja noch keine Plotter, und wir brauchten eine eigene Zeichenabteilung. Dabei ging es um Einblicke in die Physik, aber es war doch eher eine technische Arbeit. In der Wissenschaft gab es zwei Kolleginnen aus der Mathematik. In der seegehenden Ozeanographie fällt mir nur Gertrud Prahm am Deutschen Hydrographischen Institut ein. Die physikalische Meeresforschung war im Grunde Männersache.
In meiner Zeit am Institut, als wir dann auch mehr und mehr Drittmittelprojekte hatten, da suchten wir mehr Leute und so kamen immer mehr Frauen ans Institut, so dass es fast so viele wie Männer waren, die Ozeanographie könnte hier sogar ein Vorbild gewesen sein.
Dann hatten wir mit Frau Prof. Pfaff als Vizepräsidentin die erste Frau an der Spitze der Universität. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass Frauen an der Universität stärker vertreten sind. Sie führte auch ein, dass die nächste freiwerdende Hochschulassistentenstelle von einer Frau besetzt werden musste, sollte es noch keine Professorin an dem Institut geben, und ich denke das hat gut funktioniert. Einmal gab es eine Forschungsfahrt nur mit Frauen, was besonders war, da dieses Feld eine praktisch reine Männerangelegenheit war.
Ich finde das Institut hat dadurch total gewonnen und ich finde, auch Männer sollten dazu beitragen und dafür sorgen, dass sie nicht alleine unter sich sind. Die Bewegung sollte auch aus der Sicht von Männern unterstützt werden. Wissenschaft und Arbeitsgeist haben durch diese Synthese gewonnen.
Was kann man machen, um Wissenschaftlerinnen am besten zu unterstützen? Welche Aspekte sind am wichtigsten beziehungsweise die größten Hebel, und welche sind am meisten unterbeleuchtet?
Also erst einmal müssen wir unterstellen, dass Männer und Frauen gleich qualifiziert sind, und dass man von beiden genauso viel erwarten kann. Und dann muss man natürlich die Herausforderungen, die es bei Familien mit Kindern gibt, berücksichtigen und beheben. Zum Beispiel durch Arbeit von zu Hause oder die Möglichkeit, Kinder mitzubringen, für Männer wie für Frauen.
Natürlich sollte es immer um die Qualifikation gehen. Es gibt trotzdem ein unterschiedliches Wesen von Frauen und Männern und bei glücklicher Kombination, kann das das Betriebsklima und die wissenschaftliche Kreativität fördern. Ich bin kein Fan von reinen Männer- oder Frauengesellschaften.
Was braucht es aus Ihrer Sicht, um Norddeutschland attraktiv für Wissenschaftler:innen, spezifisch im Bereich physikalische Ozeanographie, zu machen?
Also einmal ist es natürlich das Meer, dass wir im Norden haben.
Außerdem ist an Hamburg reizvoll, dass es hier so viele marin-orientierte Disziplinen und Institutionen gibt – die Zusammenarbeit zwischen den Instituten haben wir damals versucht zu fördern. Für Hamburg spricht also unbedingt diese Vielfalt der marin-orientierten Einrichtungen. Etwas Besonderes ist noch das Wattengebiet, das teilweise trockenfällt. Hier gab es zum Beispiel das erste Model mit einer beweglichen Küstenlinie. Das Besondere an Hamburg ist, dass die Gezeiten bis nach Hamburg reichen. Und nach wie vor, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Anwendung.
Welche Empfehlungen würden Sie Nachwuchswissenschaftler:innen für eine erfolgreiche Karriere spezifisch im Bereich Ozeanographie auf den Weg geben?
Offen sein. Also sich nicht festlegen auf ein bestimmtes Thema, rechts und links gucken und sich auch dafür interessieren, was die anderen machen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Siehe auch: Interview mit Jürgen Sündermann von H. von Storch & H. Langenberg in HZG-Report 2019-1