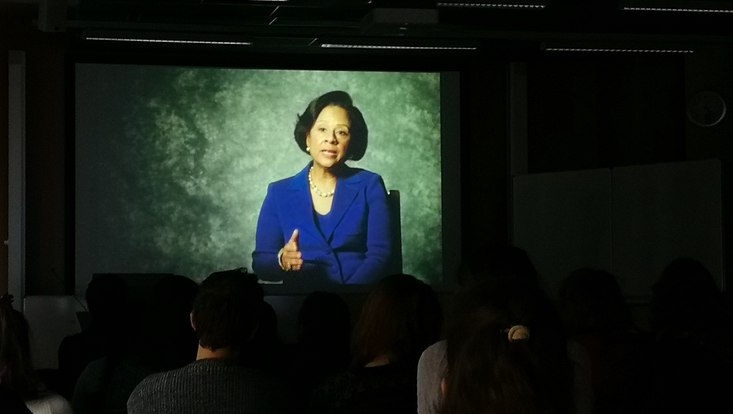für Meereskunde
Juhu, meine erste Live-Konferenz nach 1,5 Jahren Pandemie!
4. Oktober 2021, von Iuliia Polkova

Foto: Blue-Action
"Kopenhagen, ich komme!", flüsterte ich mir zu, nachdem ich endlich alle Covid-Bestimmungen aus Deutschland und Dänemark und der Uni und dem RKI und der DB gelesen hatte... Habe ich etwas vergessen? Ich bin schon lange nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist, also fühlte sich schon die Buchung eines Zugtickets von Hamburg nach Kopenhagen und eines Hotelzimmers wie eine Anstrengung an. Der Tag der Abreise ist aufregend: Es sind nur fünf Stunden Fahrt, aber ich fühle mich, als würde ich an einen sehr abgelegenen Ort auf der Erde reisen. Endlich sitze ich im Zug und eine freundliche Stimme des Zugführers erinnert die Passagiere daran, während der gesamten Fahrt medizinische Masken zu tragen, solange wir uns auf der deutschen Seite befinden. Auf der dänischen Seite müssen wir jedoch keine Masken tragen. "Lächerlich", sagen die einen, "vorsichtig", sagen die anderen.
Von den etwa 250 Konferenzteilnehmern waren 25 mutige, glückliche oder verzweifelte Teilnehmer:innen vor Ort, während alle anderen online teilnahmen. Habe ich schon gesagt, worum es bei der Konferenz eigentlich ging? Es ging um mehrjährige bis dekadische Klimavorhersagen im Nordatlantik und der Arktis (https://blue-action.eu/events/predictabilityworkshop und Proceedings). Es ging also um Vorhersagen, z.B. was und warum und wie genau vorhergesagt werden kann, und um die Menschen, Wirtschaftszweige und Regionen, die sich auf diese Vorhersagen verlassen. Für jede Sitzung hatten wir zwei Vorsitzende, die online und vor Ort - in der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften - moderierten. Die Teilnehmer stellten ihre Fragen online, und wir, die Moderatoren, kündigten sie den Referenten an. Manchmal war das etwas verwirrend und wir mussten improvisieren. Das hybride Format der Konferenz war für uns alle neu. Aber wenn man unerwartete Situationen mit einem Lächeln und ein bisschen Humor meistert, macht es Spaß und ist sogar in gewisser Weise eisbrechend. Man darf nicht vergessen, dass wir zusammen sind, um voneinander zu lernen! Aus diesem Grund und natürlich aufgrund der durchdachten Organisation dieser Veranstaltung verlief alles sehr gut, und die Konferenz wurde von den Teilnehmern online und vor Ort tatsächlich gut aufgenommen.
Meine persönlichen Forschungshighlights dieser Veranstaltung sind die Diskussionen über das Verständnis ozeanischer Prozesse, über innovative Wege zur Abschwächung von Fehlern in Klimamodellen und über Klimadienste: Hjálmar Hátún (Meeresforschungsinstitut der Färöer) gab den Anstoß zu sehr interessanten Diskussionen vor Ort darüber, wie wir die Komplexität der Meeresströmungen im subpolaren Nordatlantik messen und was wir darüber wissen. Wir brauchen mehr Beobachtungsdaten für die weit verbreiteten Konzepte der Umwälzzirkulation in den Polarregionen und der Tiefsee. Außerdem müssen wir einige vereinfachte Definitionen der Umwälzzirkulation und ihre Bedeutung für Vorhersagestudien überdenken. Mein zweites Highlight ist die Vorträge von Francine Schevenhoven (Geophysikalisches Institut, Universität Bergen und Bjerknes Centre for Climate Research, Präsentation) und François Counillon (Nansen Environmental and Remote Sensing Center und Bjerknes Centre for Climate Research, Präsentation) über die verblüffende Idee, mehrere Erdsystemmodelle zu einem Supermodell zu kombinieren, um Vorhersagefehler zu verringern. Es gibt eine Fülle von Klimamodellen, die weltweit entwickelt wurden. Sie sind als globale Modelle konzipiert, werden aber in der Regel für eine bestimmte Region entwickelt und bilden die für diese Region wichtigen Prozesse gut ab, aber nicht unbedingt global. Warum also nicht einen Weg finden, diese Modelle zu vereinen und sie voneinander lernen zu lassen, um das zukünftige Klima mit möglichst unvoreingenommenen globalen Lösungen vorherzusagen? Ist das noch real oder schon Science-Fiction? Ich finde diese Arbeit sehr inspirierend! Mein drittes Highlight ist der Vortrag von Isadora Christel Jimenez (Barcelona Supercomputing Center, Präsentation) über die Frage, was mit den Daten geschieht, nachdem sie erstellt wurden. Sie forderte uns auf, das Wasserfallmodell (für mich sah es immer wie eine Treppe aus) bei der Entwicklung eines Klimadienstes zu überdenken. Interessanterweise stellte ich auch einen zirkulären und iterativen Arbeitsablauf für die Implementierung von Klimavorhersagen für Dienstleister im Bereich marine Risiken vor, den wir mit meinen Projektpartnern von Blue-Action entwickelt haben (Poster). Ich muss jedoch sagen, dass die Idee, einen iterativen Dienst zu entwickeln, in gewisser Weise naheliegend ist. Viele Dinge, die wir im Leben tun, sind iterativ (bauen-prüfen-verbessern), warum also nicht auch Klimadienste? Eine weitere interessante Frage, die meines Erachtens nicht so oft angesprochen wird, ist die, wie die Industrie die Klimaforschung besser nutzen kann, um sich gegen Klimaveränderungen zu wappnen.
Eine tolle Veranstaltung! Ich habe darüber nachgedacht, wie die diskutierten Themen zusammenhängen und wie sie genutzt werden können, um die künftige Forschung zu Klimavorhersagen voranzutreiben. Vielleicht sind hybride Tagungen das Format für künftige wissenschaftliche Veranstaltungen. Sie haben auf jeden Fall das Potenzial weitreichender zu sein.
Autorin
Dr. Iuliia Polkova ist eine Klimawissenschaftlerin mit großem Interesse daran, Klimavorhersagen für die Gesellschaft nutzbar zu machen.