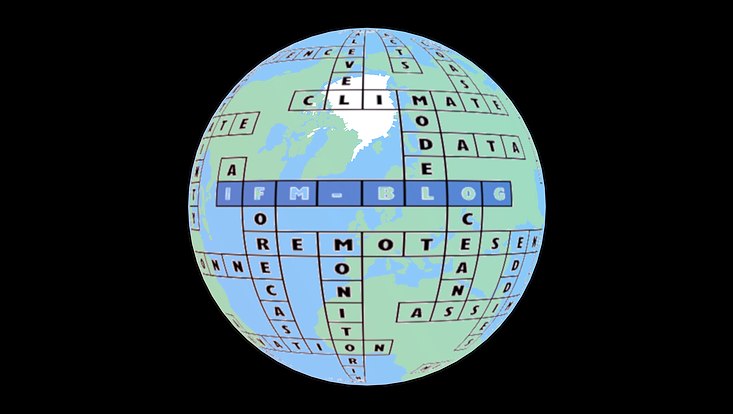für Meereskunde
Wie spricht man über das Klima...?
1. Juni 2023, von Iuliia Polkova
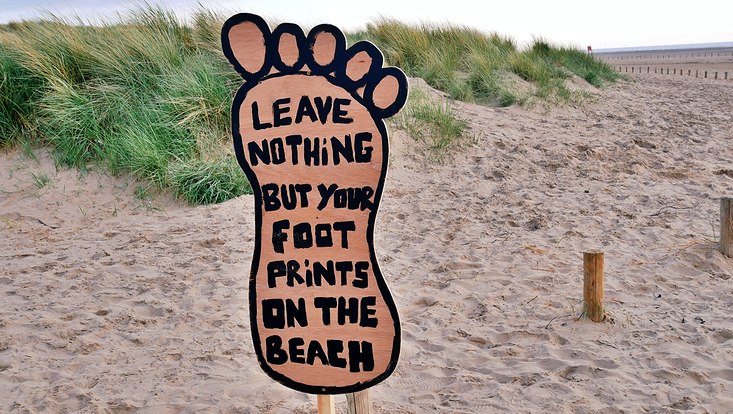
Foto: Vicky Hincks | Unsplash
Vor einiger Zeit hörte ich auf einer der Konferenzen den Satz "global denken, lokal handeln". Führende Politiker aus verschiedenen Ländern kommen zusammen, um zu erörtern, wie wir unseren Planeten zu einem besseren Ort zum Leben machen können. Sie einigen sich auf verschiedene Konzepte und Rahmenvorgaben. Aber es sind unsere Städte, Nachbarschaften, Straßen und Häuser, in denen der wahre Zauber stattfindet. Zweifellos wollen wir alle auf einem schönen Planeten leben, aber wenn es ums Handeln geht, klafft eine gewisse Lücke zwischen diesen globalen Vereinbarungen, wie dem Pariser Klimaabkommen oder den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), und der lokalen Umsetzung. Eines der Unterziele von SDG 13 "Maßnahmen zum Klimaschutz" ist die Mobilisierung von privatem Engagement. Wie sieht es damit derzeit aus? Wie mobilisiert ist unsere Gesellschaft für den Klimaschutz? Im Jahr 2021 veröffentlichte die Bundeszentrale für politische Bildung einen Bericht, in dem es unter anderem um die Wahrnehmung des Klimawandels in Deutschland geht. Die meisten Menschen in Deutschland nehmen den Klimawandel nicht nur als ein primär vom Menschen verursachtes Phänomen, sondern auch als ein ernstes Problem wahr. Die Bereitschaft, einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wird als hoch eingeschätzt. Dies ist ein interessantes Ergebnis für Klimakommunikatoren, die immer noch versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass der Klimawandel real ist. Diese Botschaften kollidieren mit denen der Klimaleugner, die in jedem Fall auf ihrem Standpunkt beharren werden. Es scheint aber, dass die Klimakommunikation einen anderen Schwerpunkt braucht, denn laut dem Bericht die meisten Menschen wissen, dass der Klimawandel real ist. Aus persönlicher Erfahrung, Menschen wollen nun wissen, was dies für ihre Stadtteile bedeutet, was sie als Nächstes tun können, um den Klimawandel abzuschwächen oder sich an ihn anzupassen, welche ihrer Handlungen einen Unterschied machen und wie sie private Klimaschutzmaßnahmen skalieren können.
Letzte Woche im Rahmen des Programms "Wir wollen's wissen!" habe ich mit Schülern über Klimamodelle gesprochen, wie sie funktionieren und warum Klimaprognosen möglich sind und für klimainformierte Entscheidungen genutzt werden können. In der Diskussion brachten die SchülerInnen ihre Frustration darüber zum Ausdruck, dass sich private Handlungen als unbedeutend anfühlen. Ich weiß genau, was sie meinen. Die australische Wissenschaftlerin Rebecca Huntley, die auch Autorin des Buches "How to talk about climate change in a way that makes a difference" ist, schlägt vor, dass eine der Lösungen zur Bekämpfung der eigenen Frustration darin besteht, einer Gruppe beizutreten oder eine Gruppe zu gründen, die sich mit Klimafragen in der lokalen Gemeinschaft befasst. Dies kann die eigene Nachbarschaft zu einem schöneren Ort zum Leben machen, was eher machbar und mehr unter unserer Kontrolle ist, als die Einstellung zu Emissionen auf der anderen Seite des Globus zu ändern. Und es kann andere dazu inspirieren, dem eigenen Beispiel zu folgen und damit den eigenen Beitrag zu erhöhen. In dem Buch geht es in erster Linie um die Gefühle, die das Thema Klimawandel bei verschiedenen Menschen auslöst, wenn sie damit konfrontiert werden, über den Klimawandel zu sprechen. Es polarisiert und frustriert oft. Wir müssen offensichtlich von Schuldzuweisungen und dem "wir-gegen-die"-Fokus Abstand nehmen, da dies nicht zur Lösung von Problemen beiträgt. Wir müssen aktives Zuhören üben und uns auf die Sache und nicht auf Persönlichkeiten konzentrieren.
Klimakommunikatoren müssen verstehen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung in Europa über Klimaprobleme besorgt ist und wahrscheinlich keine neuen Darstellungen von globalen Temperaturtrends braucht, sondern wissen will, was als Nächstes zu tun ist, um etwas zu bewirken. Ein weiterer Punkt ist, dass Besorgnis und Handeln nicht dasselbe sind. Es scheint Hindernisse zu geben, um unseren inneren Mut zu finden und zu einem klima- und umweltbewussten Lebensstil überzugehen. Sobald wir diesen Mut gefunden haben, brauchen wir Werkzeuge, um zu wissen, was zu tun ist. Es gibt eine ganze Reihe von Werkzeugen. In Deutschland zum Beispiel werden verschiedene Praktiken unter “Das Deutsche Klimavorsorgeportal – KliVO" zusammengefasst. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Instrumente leicht auffindbar sind und jeder weiß, was zu tun ist. Vielleicht könnte sogar das Wissen um die konkreten Schritte und deren Umsetzbarkeit helfen, innere Hindernisse der Handlungslosigkeit zu überwinden. In Hamburg hat zum Beispiel jeder Bezirk ein Klimabüro. Wenn Sie das nächste Mal im Bezirksamt etwas zu tun haben, schauen Sie doch mal, was das Klimabüro in Ihrem Stadtteil organisiert.
Über die Autorin
Dr. Iuliia Polkova ist eine Klimaforscherin mit großem Interesse daran, Klimavorhersagen für die Gesellschaft nutzbar zu machen.
Iuliia Polkova hat von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein Forschungsförderung erhalten, um die Initialisierung der dekadischen Klimavorhersagen zu verbessern.