für Meereskunde
Mit der Ludwig Prandtl im Jadebusen
21. Dezember 2023, von Leonie Bauer
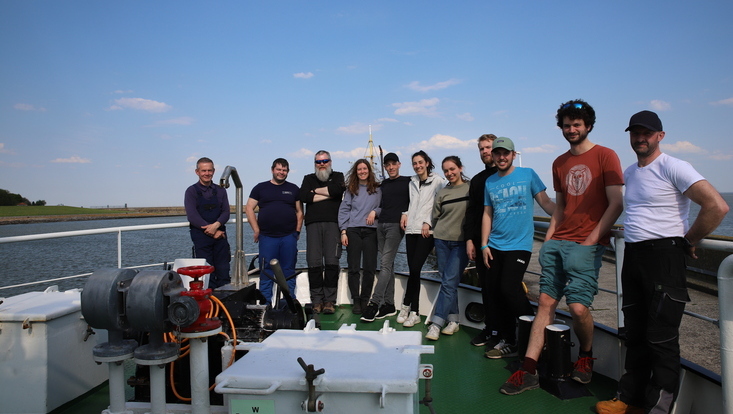
Foto: Credit: Yves Sorge
„Jojo-CTDs“, „Pütz“-Messungen, ein autonomer Katamaran, und sogar zwei oder drei Robben – das alles war Teil des Seepraktikums 2023. Hier können Sie Genaueres über unsere studentische Messfahrt im Mai erfahren.
Los ging es in Cuxhaven am 08. Mai mit der Vorbereitung des Forschungsschiffs Ludwig Prandtl. Zusammen waren wir sechs Studierende, unsere Dozenten Martin Gade und Niels Fuchs, sowie die Besatzung der Prandtl, Marco Schaft, Detlef Heinze und Lars Engelke. Zur Vorbereitung wurden Bildschirme aufgebaut, Kekse eingekauft und drei Verankerungen (so genannte Moorings) vorbereitet, indem Geräte daran befestigt wurden. Diese wurden am nächsten Tag an den vorher festgelegten Stellen ausgebracht und maßen ab diesem Zeitpunkt die Geschwindigkeit und den Salzgehalt sowie die Temperatur der vorbeifließenden Strömung. Zusammen mit anderen Messungen sollte uns dies Informationen zu den Wassermassen im Jadebusen geben.
Um zu beobachten, wie die Wassermassen durch die Gezeiten in den Jadebusen hinein- und herausfließen, wurden außerdem Messungen eines Accoustic Doppler CurrentProfiler (ADCP) benutzt. Dieses Gerät gehört genauso wie eine Ferrybox und ein Echolot zur Ausstattung der Ludwig Prandtl.
Nachdem die drei Moorings verankert waren, wurden wir auf die weiteren Messgeräte losgelassen. Es gab eine kurze Einführung zum richtigen „Pützen“, zum Proben nehmen per Wasserschöpfer, einer geglückten CTD-Messung und einigen anderen Messtechniken. Außerdem haben wir an diesem Tag gelernt, wie die Daten direkt an Bord zum ersten Mal visualisiert werden können.
Der erste Messtag startete also am 10. Mai. Während eines Telefonats mit Martina Heinecke vom Helmholtz-Zentrum Hereon konnten wir die Ferrybox noch richtig kalibrieren und schließlich loslegen. Wir definierten drei Stationen, die jeweils von zwei Personen betreut wurden, und wechselten uns dann regelmäßig damit ab. Der Tagesablauf bestand aus „Transekten“ fahren, Wasserproben nehmen, Keksen essen& Ausschau halten, die CTD ins Wasser lassen und Daten visualisieren.
Die „Transekte“ hatten wir ebenfalls vorher definiert und richteten uns dabei nach der Bathymetrie des Jadebusens. Die beiden jeden Tag wechselnden „Chief Student Scientists“ kamen jeden Morgen mit einem Tagesplan zu Marco, dem Kapitän, und besprachen mit ihm die geplanten Messungen. Diese bestanden vor allem aus dem Nachfahren eines Transekts und dem Stopp für die Messungen. Beim Fahren von Transekten geht es darum, eine vordefinierte Strecke mit konstanter Geschwindigkeit abzufahren. Das ADCP-Gerät, das die ganze Zeit mitläuft, misst dann das Geschwindigkeitsprofil dieses Transekts. Das heißt, die Strömungsgeschwindigkeitsverteilung über die Länge des Transekts, sowie über die Tiefe können somit ermittelt werden. Daraus haben wir später die Strömung und den Volumentransport durch die verschiedenen Transekte berechnet. Nachdem wir den Transport zu verschiedenen Gezeitenphasen berechnen wollten, sollte das Abdecken der Transekte gut geplant sein. Nachdem der Transekt abgefahren worden war, haben wir meistens eine Pause eingelegt, um an unseren drei Stationen zu messen. Eine Person notierte Zeit und Ort der Messung und dann wurde die CTD herabgelassen und die Messung protokolliert. Die andere Station bestand aus dem Wasserschöpfer, mit dem eine Flasche aus dem Labor der Prandtl befüllt wurde. Bei dieser Messung half uns Lars, indem er den Wasserschöpfer auf die gewünschte Tiefe herabließ, sodass wir eine Wasserprobe bekommen konnten. Ein weiteres Team schöpfte Oberflächenwasser mit einem Eimer an der Pützstation. Temperatur und Salzgehalt des Wassers wurden gemessen und notiert, außerdem wurden die von der Ferrybox gemessenen Werte aufgeschrieben und die Windstärke an Deck des Schiffs gemessen. Die CTD misst Leitfähigkeit und Temperatur des Wassers, sowie die Wassertiefe und die Trübung, und gibt damit Rückschlüsse auf verschiedene Wassermassen. Diese kann man beispielsweise an verschiedener Temperatur- und Salzverteilungen erkennen. Diese Daten wurden ebenfalls in unserem Praktikumsbericht ausgewertet. Der Tag endete mit gemeinsamen Wraps essen.
Am Morgen des 10. Mai waren wir außerdem noch am Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) in Wilhelmshaven zu Besuch. Dort trafen wir uns mit Herrn Professor Wurl, der uns den autonom fahrenden Katamaran „Halobates“ der Uni Oldenburg zeigte, mit dem sich Austauschprozesse an der Wasseroberfläche messen lassen.
Im Einsatz sahen wir Halobates dann am nächsten Tag. Wir trafen uns an einem vereinbarten Ort und sahen Halobates bei seinen Messungen zu. Natürlich machten wir auch unsere eigenen, hierbei kamen die Jojo-CTD-Messungen zum Einsatz, wir ließen die CTD also 10-mal herunter und wieder herauffahren.
Nach einem weiteren Messtag am Freitag, dem 12. Mai, ging es am Samstag auch schon wieder zu den Moorings, um diese aus dem Wasser zu holen. Dies funktionierte gut, allerdings mussten wir beim Auswerten der Daten feststellen, dass eine der Verankerungen eine Zeit lang dank des starken Stroms gekippt war. Die Messung der Zeitreihe konnte trotzdem ausgewertet und verwendet werden. Highlight des Tages war noch eine späte Robben-Sichtung.
Am Sonntag verabschiedeten wir uns vom Jadebusen und verbrachten den Tag damit, die Messgeräte wieder einzupacken, Daten herunterzuladen und den Ausblick auf der Bank an Deck zu genießen, während wir wieder nach Hamburg fuhren.
Die Ergebnisse des Seepraktikums wurden im Rahmen einer Präsentation inklusive Poster-Session vorgestellt.
Ein herzliches Dankeschön nochmal an Martin, Niels, Marko, Detlef und Lars für die Unterstützung!











